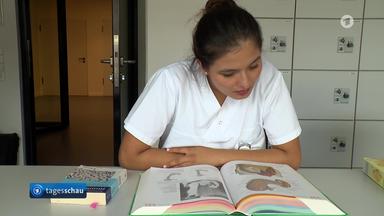Millionenförderung für mitteldeutsche Forschung zu psychischen Erkrankungen
Rund 17,3 Millionen Euro fließen an Forschungsstandorte in Halle, Jena und Magdeburg, um dort die Arbeit im Rahmen des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit (DZPG) fortzusetzen. Die Mittel stammen vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Ziel ist es, die Entstehung psychischer Erkrankungen besser zu verstehen und daraus konkrete Ansätze für Prävention und Versorgung zu entwickeln. Psychische Erkrankungen gehören zu den häufigsten und zugleich belastendsten Volkskrankheiten.
Mit der neuen Förderung startet die Ausbauphase des mitteldeutschen Standorts, der seit 2023 Teil des DZPG ist. Hier bündeln die Universitäten Halle, Jena und Magdeburg sowie ihre Universitätskliniken ihre Expertise mit den Leibniz-Instituten für Neurobiologie in Magdeburg und für Naturstoffforschung und Infektionsbiologie in Jena. Der mitteldeutsche Standort ist einer von sechs in ganz Deutschland. Jeder hat andere Forschungsschwerpunkte.
Forschungsschwerpunkte in Mitteldeutschland
An der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg stehen Prävention, Resilienz und Intervention im Vordergrund. "Das DZPG ist ein Meilenstein in der Erforschung psychischer Gesundheit und eröffnet die Möglichkeit, interdisziplinär mit einem gemeinsamen Forschungsprogramm dazu beizutragen, die wissenschaftliche Evidenz für Resilienz, Prävention und Interventionen für psychische Störungen in Deutschland zu stärken", sagt Psychologe Ronny Redlich, Sprecher des Teilstandortes Halle.
Oliver Tüscher, Direktor der Universitätsklinik und Poliklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik der Universitätsmedizin Halle, ergänzt: "In Halle haben wir mit den Schwerpunkten Früherkennung und Alternsforschung beste Voraussetzungen, die Besonderheiten psychischer Störungen und deren Therapie in den verschiedenen Lebensphasen über die gesamte Lebensspanne gemeinsam im DZPG zu erforschen."
Insgesamt arbeiten über 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen an sieben Schwerpunktprojekten, die vor allem die Funktionsweise des Gehirns und Veränderungen in seinen Schaltkreisen untersuchen – von sozialer Interaktion bis zu Entzündungsmechanismen. Für Standortsprecher Martin Walter vom Universitätsklinikum Jena ist die Förderung ein entscheidender Schritt: "Eine verlässliche, langfristig planbare Förderung ist unerlässlich für die Zusammenführung aller relevanten Forschungsbereiche und die Verwertung neuartiger Erkenntnisse im klinischen und gesellschaftlichen Kontext."
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke