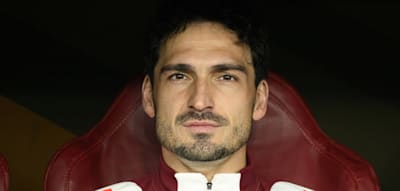Wer regiert Hamburg?
Am 16. Februar 2011 traf der FC St. Pauli letztmals in der Bundesliga im Hamburger Volksparkstadion auf den großen Rivalen. 1:0 siegte der Kiezklub damals, Gerald Asamoah traf, St. Pauli durfte sich Stadtmeister nennen und der damals noch große HSV stand fassungslos da. Im Nachhinein wirkt es wie der Startschuss zur Neusortierung der Machtverhältnisse in der Stadt.
Das Hamburger Derby ist von jeher ein Aufeinandertreffen, das die Stadt in zwei Lager spaltet. Pfeffersäcke gegen Rebellen, Vorort gegen Innenstadt, Volkspark gegen Millerntor. Ein Duell, das jetzt – 14 Jahre später – zurückkehrt auf die größte Fußballbühne des Landes: die Bundesliga. Ende August, zweiter Spieltag, unter Flutlicht im Volkspark. Und es wirft Fragen auf: Wer ist der HSV mittlerweile? Wie hat sich St. Pauli entwickelt? Und über allem: Wer gibt in Hamburg den Ton an?
Die Rivalität zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli ist historisch gewachsen und war nicht immer so groß, wie sie heute ist. Der HSV, gegründet 1887, war der Klub der Titel und des Großbürgertums. Sechs deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokalsiege, zwei Europapokalsiege, Gründungsmitglied der Bundesliga. Der Verein zog Fans aus allen Ecken der Stadt und darüber hinaus an – aber in den 1980er-Jahren wurde es dunkel. Die Kurve wurde von rechtsextremen Gruppen wie den „Hamburger Löwen“ dominiert.
Viele, vor allem junge HSV-Fans suchten ein neues Zuhause. Und fanden es beim FC St. Pauli, dem kleinen Stadtteilverein. Dort, auf dem Kiez, entstand eine neue Fanszene: Punks, Aktivisten und Subkultur. Der Totenkopf wurde zum Symbol. Die Spiele beider Klubs wurden bald mehr als sportliche Wettkämpfe. Es waren politische Veranstaltungen und kulturelle Reviermarkierungen. Der HSV stand für das Etablierte und St. Pauli für den Aufstand.
Gewalt und Grenzüberschreitungen
Das Hamburger Derby ist mittlerweile zu einem der emotionalsten und zugleich explosivsten Spiele Europas geworden. Die Gewaltbereitschaft im Umfeld dieser Partie ist seit Jahrzehnten hoch. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen der verfeindeten Lager. 2024 kam es rund um das Osterstraßenfest zwischen beiden Fanlagern zu einer Massenschlägerei mit mehreren Verletzten. In Buchholz überfielen im Juni 2023 HSV-Anhänger eine Gruppe junger St.-Pauli-Fans an einer Bushaltestelle, jagte sie durch die Straßen. Immer wieder wird der „heilige Boden“ des jeweils anderen – Fanläden, Choreo-Räume, Kneipen – zum Ziel von Angriffen. Die meisten Auseinandersetzungen werden gar nicht publik.
Beim 111. und bislang letzten Stadtderby im Mai 2024 musste die Polizei mit 1900 Beamten eingreifen, um eine Eskalation zu verhindern. Auch Hubschrauber und Reiterstaffeln kamen zum Einsatz. Die Hamburger Einsatzkräfte benötigten sogar Unterstützung aus anderen Bundesländern und von der Bundespolizei. Der Mythos lebt – auch oder gerade weil er so gefährlich nahe an der Eskalation gebaut ist.
Vereine im Wandel
Die Rivalität ist weiterhin groß, doch die Stadt hat sich verändert. Und mit ihr haben sich auch die Vereine weiterentwickelt. Der HSV ist nicht mehr der große Gigant, der alles überragt. Der Abstieg aus der Bundesliga 2018 war ein Schock. Sieben Jahre in der Zweiten Liga folgten. Jedes Jahr neue Trainer, neue Strategien und dieselben alten Fehler. Erst mit der Ankunft von Stefan Kuntz 2024 als Sportvorstand veränderte sich die Herangehensweise. Gemeinsam mit Finanzchef Eric Huwer strukturierte er den Verein neu. Aus dem ewigen „Nur der HSV“ wurde mehr und mehr „Arbeiten statt Reden“.
Kuntz hat dem HSV die Bodenständigkeit beigebracht. Keine Europaeuphorie mehr, kein Platz mehr für Selbstüberschätzung. „Was die Intensität angeht, werden wir extrem viel abverlangt bekommen“, sagt er, „wir haben in der Analyse der Vorsaison festgestellt, dass wir mit allen Laufdaten abgeschlagen auf Platz 18 der Bundesliga gelandet wären.“ Das Saisonziel? „Das ist definitiv der Klassenverbleib. Wir haben ein paar Jahre nachzuholen und müssen ein paar Jahre in der Bundesliga bleiben, um auf die einzigartige Kraft von Hamburg zurückgreifen zu können.“
Sinnbildlich für diesen Neustart steht Trainer Merlin Polzin. 34 Jahre jung, sachlich, akribisch. Und mit Unterstützung aus der Führungsetage. Der HSV hat die Verträge mit dem Chefcoach und seinen Co-Trainern Loïc Favé und Richard Krohn schon vor der neuen Saison verlängert. Sportvorstand Kuntz erklärt den Schritt so: „Wir gehen diesen Schritt aus voller Überzeugung, und unser Signal ans Trainerteam und das Umfeld ist klar: Wir wollen damit Sicherheit und Rückendeckung für die kommenden Aufgaben geben.“
Beim FC St. Pauli sind sie währenddessen schon deutlich weiter. Still und effizient wurde gearbeitet – und nachhaltig. Unter Sportchef Andreas Bornemann und Trainer Alexander Blessin wurde eine Mannschaft aufgebaut, die in der Bundesliga nicht nur überleben will. „Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch einiges zu tun“, sagt Blessin, „wir müssen daran arbeiten, unsere Chancen noch konsequenter zu nutzen.“ Die Mannschaft steht laut dem Cheftrainer zusammen: „Sie haben im Trainingslager viel Zeit zusammen verbracht und sich viel miteinander auseinandergesetzt.“
Mainstream und Identitätssuche
Mit den beiden Klubs hat auch das Derby sich verändert: Es ist mittlerweile ein Kampf auf Augenhöhe. Beide Vereine sind in der Bundesliga. Und beide haben ihre Identität überdacht, aber nicht verloren. St. Pauli hat die Rebellion professionalisiert. Die Anti-Haltung bleibt, aber sie ist eingebettet in eine durchstrukturierte Vereinsstrategie. Der Klub, der sich über Jahrzehnte als Anti-Marke verstand, ist heute selbst zur Marke geworden. Der Totenkopf, einst Symbol für Widerstand, ziert längst Babystrampler, Espressotassen und Boutique-Schaufenster weit über die Grenzen des Viertels hinaus.
St. Pauli begeistert heute genauso die LinkedIn-affine Start-up-Gründer aus der Schanze wie Punks auf dem Kiez. Beim bislang letzten Derby hielten HSV-Fans ein Banner hoch: „Du bist hier? Und wer trinkt dann Latte in der Schanze?“ Eine spöttische Erinnerung daran, dass der rebellische Kiezklub längst im kulturellen Mainstream angekommen ist. Der politische Anspruch ist geblieben – gegen Rassismus, gegen rechts, für Vielfalt –, aber er steht heute neben professionellem Management, Merchandisingstrategien und internationaler Markenpflege. Die Genossenschaftsstruktur, die Fanbeteiligung sind aber auch weiterhin gelebte Praxis.
Auch der Hamburger SV hat in den vergangenen Jahren eine Wandlung durchlebt – wenn auch in eine ganz andere Richtung. Der Verein, der sich lange auf seiner ruhmreichen Geschichte ausgeruht hatte, ist nach dem Abstieg 2018 hart in der Realität angekommen. Aus dem selbsternannten Bundesliga-Dino, der sich über Jahrzehnte für unantastbar hielt, wurde ein Zweitligaverein mit Identitätskrise. Die Großspurigkeit früherer Jahre ist einer betont nüchternen Kommunikation gewichen. „Demut“ und „Realismus“ sind die neuen Schlüsselbegriffe. Die wirtschaftliche Sanierung ist gelungen. Auch auf den Tribünen hat ein Umdenken stattgefunden. Die Fanszene, einst zumindest in Teilen offen für rechte Tendenzen oder zumindest unpolitisch, zeigt heute klare Haltung: Antirassistische Statements, kreative Kurvenarbeit, eine wachsende Ultra-Kultur. Doch anders als der Stadtnachbar sucht der HSV noch nach dem neuen Selbstbild.
Neue Saison, neue Gesichter
In der Saison 2024/2025 blieb St. Pauli souverän in der Bundesliga, überzeugte vor allem defensiv – nur Meister FC Bayern kassierte weniger Tore. Der HSV schaffte nach mehreren gescheiterten Anläufen endlich den Aufstieg. Doch während Hamburg noch feierte, dämmerte es den Verantwortlichen schon: Der Bundesligaalltag wird brutal. Der HSV musste vor der Saison schmerzhafte Abgänge verkraften. Ludovit Reis wechselte nach Brügge, Davie Selke zu Basaksehir. Doch es wurde nachgelegt: Jordan Torunarigha (KAA Gent) soll Stabilität in die Abwehr bringen, Daniel Peretz (FC Bayern) den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition erhöhen, und Yussuf Poulsen (RB Leipzig) bringt reichlich Bundesligaerfahrung mit. Die neuen Spielidee: Intensität statt Ballbesitz.
St. Pauli hingegen wirkte in der Saisonvorbereitung sortiert. Blessin will „den nächsten Schritt gehen“. Der Klub setzte auf punktuelle Verstärkung der Offensive: Morgan Guilavogui (RC Lens), Andréas Hountondji (FC Burnley) und Ricky-Jade Jones (Peterborough) sollen für mehr Tore sorgen.
Wenn am 29. August, 20.30 Uhr, im Volksparkstadion der Ball rollt, geht es nicht bloß um Punkte – es geht um die Frage: Wer regiert Hamburg? Eine Frage, die so offen ist wie vielleicht nie zuvor...
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke