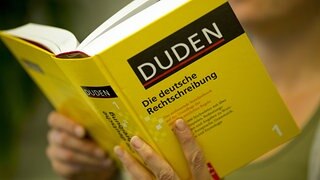Zugausfälle und volle Waggons: Warum in Sachsen der Nahverkehr ausgebremst wird
- Finanzlücke beim Verkehrsverbund: Wenn Zugausfälle Geld sparen
- Der Konflikt um die Regionalisierungsmittel für Sachsen
- Verkehrsverbünde kritisieren Freistaat Sachsen
- Wirtschaft und Kommune fordern Tempo beim Bahnausbau
Dicht gedrängt stehen Pendler immer wieder in den Regionalzügen zwischen Leipzig, Dresden und Chemnitz. Diese Verbindungen gelten seit Jahren als überlastet. Trotz steigender Fahrgastzahlen fehlt es an Investitionen in moderne Fahrzeuge und bessere Infrastruktur.
Allein auf der Strecke zwischen Leipzig und Dresden – einer zentralen Pendlerachse – wurden im ersten Halbjahr 2025 laut Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) 131 Zugausfälle registriert. Der RE50, der auf dieser Route verkehrt, ist regelmäßig überfüllt.
Zugausfälle auf der Strecke Leipzig-Dresden: Warum der RE50 so oft streikt
Während sich die Fahrgastzahlen seit 2009 von 2,8 Millionen auf über fünf Millionen fast verdoppelt haben, ist die Kapazität nahezu gleichgeblieben. Der Einsatz längerer Züge scheitert häufig an zu kurzen Bahnsteigen, deren Verlängerung teuer wäre.
So brauchen die Menschen besonders starke Nerven, wenn sie zur Rushhour mit dem RE50 fahren. Zwar gibt der Verkehrsverbund eine Auslastung von 80 Prozent an – doch Fahrgäste berichten von vollen Gängen und Gedränge. Ein Pendler erklärt: "Da ist es immer voll. Man findet keinen Sitzplatz. Es ist ein richtiges Reindrücken."
Michael Koch vom Fahrgastverband ProBahn kritisiert seit langem die chronische Überfüllung der Züge und die Auswirkungen: "Also die Fahrgäste haben verlängerte Fahrzeiten, vielleicht verlorene Anschlüsse, sind später zu Hause oder kommen zu spät auf Arbeit an." Pro Bahn fordert mehr Verbindungen.
Finanzlücke beim Verkehrsverbund: Wenn Zugausfälle Geld sparen
Der Betreiber des RE50, die DB Regio Südost, will sich nicht äußern und verweist auf den zuständigen Verkehrsverbund Oberelbe. "Selbstverständlich wollen wir mehr beauftragen", sagte VVO-Sprecher Christian Schlemper. "Doch mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln können wir schlichtweg nicht mehr beauftragen, weil wir sie nicht bezahlen können."
Mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln können wir schlichtweg nicht mehr beauftragen, weil wir sie nicht bezahlen können.
Das Budget des Verkehrsverbundes ist Schlemper zufolge so knapp, dass paradoxerweise Zugausfälle helfen, weil dann weniger gezahlt werden müsse. Im aktuellen Haushalt des Verkehrsverbundes fehlten ein paar Millionen. "Diese Lücke können wir nur dadurch schließen, weil die Deutsche Bahn aufgrund von Personalmangel nicht alle Züge fahren kann, die wir bei der Deutschen Bahn bestellt haben."
Der Konflikt um die Regionalisierungsmittel für Sachsen
Ein zentraler Streitpunkt ist die Frage, wie das Land Sachsen mit den sogenannten Regionalisierungsmitteln umgeht – also jenen Bundesgeldern, mit denen die Länder ihren Regionalverkehr finanzieren sollen.
Seit der Bahnreform 1996 liegt die Verantwortung für den Nahverkehr bei den Ländern. Der Bund unterstützt sie dafür mit Milliardenbeträgen. Allein in diesem Jahr erhält der Freistaat Sachsen 709 Millionen Euro, dazu kommen 43 Millionen Euro für das Deutschlandticket. Doch nicht das gesamte Geld landet bei den Verkehrsverbünden, die für die Bestellung von Zügen verantwortlich sind.
Wie das System funktioniert
Kurz gesagt: Der Bund zahlt das Geld, das Land verteilt es weiter, die Verkehrsverbünde bestellen – und am Ende fahren die Bahnunternehmen. In Sachsen gibt es fünf solcher Verkehrsverbünde, etwa den Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) oder den Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS). Sie entscheiden, wie viele Züge auf welchen Strecken fahren, in welchem Takt – und mit welchen Fahrzeugen.
Doch hier liegt das Problem: Der Freistaat behält einen Teil der Bundesmittel ein, um damit eigene Projekte zu finanzieren. Laut Staatsministerium für Infrastruktur leitet Sachsen aktuell rund 85 Prozent der Mittel an die Verkehrsverbünde weiter. Der Rest fließt in landesweite Programme wie das PlusBus-Netz oder in Infrastrukturinvestitionen.
Verkehrsverbünde kritisieren Freistaat Sachsen - ein ostdeutsches Problem
Außerdem kritisieren der Verkehrsverbund Oberelbe sowie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), dass der Freistaat zudem bestimmte Bereiche wie den Ausbildungsverkehr oder Investitionen in den ÖPNV nicht durch Landesmittel finanziert, obwohl sie aus Sicht des VDV eigentlich aus dem Landeshaushalt gedeckt werden müssten. So bliebe zu wenig Geld für den Zugverkehr übrig, etwa um zusätzliche Verbindungen zu bestellen oder modernere Fahrzeuge einzusetzen.
Laut VDV sei das vor allem gängige Praxis in den neuen Bundesländern – häufig aus finanziellen Gründen. Die Länder setzen überdurchschnittlich stark auf Bundesmittel, stellen aber selbst vergleichsweise wenig eigene Haushaltsmittel bereit.
Ministerium verteidigt Mittelverwendung
Das zuständige Ministerium verteidigt gegenüber MDR Investigativ die gängige Praxis: "Die entsprechende Mittelverwendung wurde bislang vom Bund nicht beanstandet, da sie den Vorgaben des Regionalisierungsgesetzes entspricht."
Kritik an dieser Vorgehensweise übte der Bundesrechnungshof 2023 in einem Bericht: "Aus Sicht des Bundesrechnungshofes ist es bedenklich, dass die Länder und ihre Aufgabenträger die steuerlichen Zuweisungen des Bundes […] nicht für den gesetzlichen Zweck verausgabt hatten. […] Mit Blick auf die hohe gesellschafts- und umweltpolitische Bedeutung eines leistungsfähigen ÖPNV sowie den unstrittigen Handlungsbedarf ist es angezeigt, dass die Länder diese Mittel alsbald zweckentsprechend verwenden."
Die Bundesregierung sieht Handlungsbedarf – laut Koalitionsvertrag soll künftig klarer geregelt werden, dass Bundesmittel auch tatsächlich im Zugverkehr ankommen.
Zwischen Leipzig und Chemnitz: Ein Gleis und alte Züge
Auch in den Zügen zwischen Leipzig und Chemnitz ist es enger geworden. Die Zahl der Fahrgäste ist in den vergangenen fünf Jahren um 40 Prozent gestiegen – auf 1,8 Millionen. "Es passiert ziemlich oft, dass dieser Zug sehr voll ist und auch ältere Leute stehen müssen", sagt Theaterpädagoge Richard Wagner, der auf der Strecke zweimal pro Woche pendelt. Fällt zusätzlich die Klimaanlage aus oder ist keine Toilette verfügbar, werde die Fahrt für zur Belastung. "Dann fährt man vielleicht gar nicht mehr."
Eigentlich sollten dort bereits seit 2024 neue Akku-Züge fahren, die der Verkehrsverbund Mittelsachsen bestellt hatte. Doch der Hersteller Alstom hinkt durch Pandemie, Ukrainekrieg und Technikprobleme hinterher. Stattdessen fahren ältere, anfälligere Ersatzfahrzeuge. Laut Alstom sollen Ende 2025 die neuen Züge kommen.
Doch auch dann bleibt die Strecke Chemnitz-Leipzig ein Nadelöhr. Sie ist größtenteils eingleisig und wird von mehreren Unternehmen befahren. Seit Jahren hofft die Region auf einen zweigleisigen, elektrifizierten Ausbau für häufigere und verlässlichere Verbindungen.
Wirtschaft und Kommune fordern Tempo beim Bahnausbau
Ausgerechnet im Kulturhauptstadt-Jahr wollte der Freistaat die Planung für den Ausbau wegen fehlender Mittel pausieren. Die IHK Chemnitz reagierte mit einer Petition – auch die Wirtschaft benötige die Strecke dringend.
"Wir haben Unternehmen, die sagen, wir entwickeln eher andere Niederlassungen als die Niederlassung in Chemnitz, weil die Region schlechter angeschlossen ist", sagt der Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, Christoph Neuberg. "Auch weil Unternehmen auf diese zusätzlichen Fachkräftepotenziale, die Pendler, eben angewiesen sind."
In Chemnitz fühlt man sich abgehängt
Inzwischen hat der Freistaat die Gelder freigegeben. Der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) fordert, dass der Freistaat nun Wort hält und das Projekt konsequent vorantreibt. Denn: "Es dauert einfach länger, bis man von hier wegkommt oder hierherkommt. Das beeinflusst Entscheidungen, ob ich mich hier ansiedle als Unternehmen, ob ich hier wohnen möchte als Mensch, ob ich hier studieren möchte als Student oder ob ich herkomme als Tourist und Geschäftsreisender." Man habe das Gefühl des Abgehängtseins.
Es dauert einfach länger, bis man von hier wegkommt oder hierherkommt. Das beeinflusst Entscheidungen.
Das gilt in Sachsen offenbar sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum. Ohne gezielte Investitionen und strukturelle Reformen durch den Freistaat drohen Fahrgästen auch in den kommenden Jahren volle Züge und lange Wartezeiten.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke