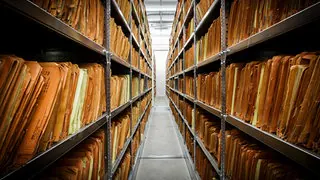Kriegsfaktor Maskulinität: Wie gewaltvolle Männlichkeitsbilder militärische Konflikte begünstigen
Um zu erklären, wieso Kriege ausbrechen, wird zuvorderst die Politik oder die Geschichte analysiert. Eine neue Studie von Alexander Yendell vom Forschungsinstitut Gesellschaftlicher Zusammenhalt Leipzig und David Herbert von der Universität Bergen wählt einen anderen Zugang, um zu untersuchen, wieso es zu militärischen Konflikten kommt: die psychologischen Wurzeln. Und die – so die zentrale Erkenntnis der Untersuchung – lägen vor allem in verhärteten, gewaltlegitimierenden Männerbildern.
"Maskulines Männerbild" sagt Kriegsbefürwortung besonders voraus
Yendell und Herbert werteten die Befragung von 1.000 Briten im Jahr 2023 aus. Sie untersuchten, wie autoritäre Persönlichkeitseigenschaften, maskulinitätsbezogene Gewalt und politische Ideologie die Unterstützung militärischer Konflikte beeinflussen. Die Wissenschaftler machten einen herausragenden Faktor aus, der bewaffnete Auseinandersetzungen besonders begünstigt: Wer Gewalt im Namen eines "maskulinen Männerbilds" gutheißt – etwa, dass Männer ihre Familie mit Gewalt schützen oder für Ehre kämpfen sollen –, befürwortet Krieg weitaus häufiger.
Daneben verstärken auch autoritäre Unterordnung, radikale politische Ansichten – und vor allem sadistische Charakterzüge, also die Lust daran, andere zu quälen oder zu demütigen – die Bereitschaft, Kriege zu befürworten. "Kriege sind nicht nur das Ergebnis strategischer Entscheidungen. Sie spiegeln tiefsitzende psychische Strukturen wider – und an vorderster Stelle stehen gewaltverherrlichende Männerbilder", sagt Yendell.
Männer und Ältere tendenziell militärischen Konflikten mehr zugeneigt
Die Studie zeige weiterhin: Wer als Kind Gewalt oder Misshandlung erlebt hat, entwickelt eher autoritäre, sadistische und rigide Männlichkeitsvorstellungen – und steht später Kriegen meist weniger kritisch gegenüber. Solche Erfahrungen förderten Denkmuster, die Gewalt rechtfertigen. Ebenfalls würden radikale politische Ideologien und rechtsgerichtete politische Ausrichtungen die Zustimmung zu Kriegshandlungen steigern. Männer und ältere Personen zeigten tendenziell eine höhere Kriegsunterstützung.
Link zur Studie
Die Untersuchung "Authoritarianism and the Psychology of War: Exploring Personality Traits in the Legitimation of Military Conflict" wurde in "Politics & Governance" publiziert.
idw/jar
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke