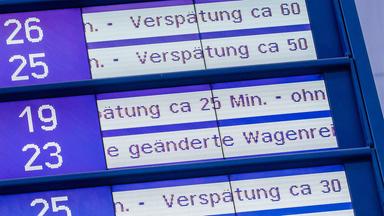AfD zieht in Umfrage mit Union gleich
Im ARD-DeutschlandTrend äußert eine Mehrheit Zweifel am Funktionieren der Demokratie. Die Unzufriedenheit mit der Regierung bleibt hoch. In der Sonntagsfrage erzielt die AfD ihr bislang bestes Ergebnis.
Selten ist eine Jahreszeit unter einer solchen Last an Erwartungen gestartet wie dieser Herbst. Es solle ein "Herbst der Reformen" werden, hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) mehrfach angekündigt. Sicher in der Hoffnung, damit nicht nur eine Entlastung der Sozialsysteme, sondern auch Aufwind für die eigene Regierung zu bewirken. Zunächst aber bläst dieser Herbst den Regierungsparteien CDU, CSU und SPD stürmisch ins Gesicht.
Die größte Oppositionspartei AfD kann in der Gunst der Wählerschaft weiter zulegen und erzielt in diesem Monat mit 26 Prozent (+1 im Vergleich zu September) ihren bislang höchsten Wert im ARD-DeutschlandTrend. Damit liegt sie gemeinsam mit der Union (ebenfalls 26, -1) erstmals ganz vorn. Die SPD kommt unverändert auf 14 Prozent, Grüne auf 12 (+1) und Linke weiter auf 10 Prozent. BSW (-1) und FDP liegen mit je 3 Prozent unterhalb der Mandatsschwelle. Alle anderen Parteien kommen zusammen auf 6 Prozent.
Aufwärtstrend der AfD seit August 2024
Eine andere repräsentative Befragung, die das ZDF mit der Forschungsgruppe Wahlen an diesem Donnerstag veröffentlicht hat, misst etwas andere Zahlen: Die Union (27 Prozent) liegt in der Sonntagsfrage dort etwas vor der AfD (25 Prozent). Eine derart leichte Abweichung zwischen den Instituten trotz gleichen Befragungszeitraums lässt sich mit der üblichen Schwankungsbreite bei repräsentativen Befragungen erklären.
Im ARD-DeutschlandTrend beträgt die Fehlertoleranz zwischen 2 und 3 Prozentpunkten. Das bedeutet: Bei einem gemessenen Wert von 10 Prozent kann der tatsächliche Wert bis zu 2 Punkte darüber oder darunter liegen, also zwischen 8 und 12 Prozent. Bei einem Ergebnis von 50 Prozent kann der tatsächliche Wert bis zu 3 Punkte darüber oder darunter liegen, also zwischen 47 und 53 Prozent.
Belastbar sind kleinere Veränderungen in der politischen Stimmung deshalb vor allem, wenn sie sich über mehrere Monate zu einem Trend verfestigen. Im Fall der AfD hat sich in den vergangenen Monaten über die verschiedenen Institute hinweg eine wachsende Zustimmung gezeigt. Im ARD-DeutschlandTrend hat sich die Partei seit August 2024 um 10 Prozentpunkte verbessert - von damals 16 auf nun 26 Prozent.
Dass der Zuspruch für die AfD wächst, hat verschiedene Gründe. Schon der DeutschlandTrend Anfang September hat gezeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger der Partei inzwischen auf mehreren Politikfeldern relevante Kompetenzen zutrauen. Die selbsternannte Alternative für Deutschland profitiert aber auch von der Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, die in den vergangenen Monaten kontinuierlich gewachsen ist - von 51 Prozent Anfang Juni auf mittlerweile 77 Prozent.
Zweifel am Funktionieren der Demokratie
Die AfD profitiert zudem von wachsenden Zweifeln am Funktionieren der Demokratie. Nur noch eine Minderheit von 42 Prozent ist mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, zufrieden. 56 Prozent hingegen sind damit weniger bzw. gar nicht zufrieden. Am größten ist die Unzufriedenheit unter den AfD-Anhängern mit 91 Prozent.
In der Frage, worin derzeit die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland besteht, teilen sich die Wahlberechtigten in verschiedene Lager. Für die AfD-Anhänger sind es vor allem das als dysfunktional empfundene Handeln von Politik, Institutionen und Behörden (35 Prozent) sowie das Thema Migration (16 Prozent). Die Anhänger aller anderen im Bundestag vertretenen Parteien empfinden Rechtsextremismus und -populismus als größte Gefahr für die Demokratie.
63 Prozent der Grünen-Anhänger, 52 Prozent der Linken-Anhänger, 51 Prozent der SPD-Anhänger und 39 Prozent der Unions-Anhänger nennen bei offener Frage an erster Stelle dieses Thema. An zweiter Stelle folgt auch bei diesen Partei-Anhängern jeweils das als dysfunktional empfundene Handeln von Politik, Institutionen und Verwaltung - allerdings mit deutlich geringeren Werten als bei AfD-Anhängern.
Leichte Mehrheit für entschlossene NATO-Reaktion
Während die Bundesregierung im "Herbst der Reformen" um ihren innenpolitischen Kurs ringt, sieht sie sich auch internationalen Herausforderungen gegenüber. Da wäre zum einen die hybride Bedrohungslage. So gab es in mehreren Ländern zuletzt Drohnensichtungen über kritischer Infrastruktur, bei denen die Urheber bislang oft nicht eindeutig geklärt sind. Zugleich gab es mehrere Vorfälle, bei denen eindeutig russische Militärflugzeuge und Kampfdrohnen den Luftraum von NATO-Staaten verletzt haben.
In dieser Situation spricht sich eine leichte Mehrheit der Deutschen für eine entschlossene Reaktion aus: 54 Prozent sind der Ansicht, die NATO sollte eher entschlossen agieren und Härte gegenüber Russland zeigen. Jeder dritte Deutsche (34 Prozent) meint hingegen, die NATO sollte eher zurückhaltend sein, um Russland nicht zu provozieren.
Interessant: Die Sorge der Deutschen, Russland könne weitere Länder in Europa angreifen, bleibt zwar auf hohem Niveau, ist im vergangenen halben Jahr aber nicht angestiegen. 63 Prozent haben diesbezüglich sehr große bzw. große Sorgen (-2 im Vergleich zu April). 35 Prozent haben derzeit wenig bzw. gar keine Sorgen, dass Russland weitere Länder in Europa angreift.
Kritik am militärischen Vorgehen Israels wächst
Ein anderes Handlungsfeld bleibt der Nahe Osten. Fast zwei Jahre sind nun vergangen seit dem 7. Oktober 2023, an dem die islamistische Terrororganisation Hamas Israel überfiel, etwa 1.200 Menschen tötete und 250 Geiseln nahm. Israel reagierte mit Luftangriffen und Bodentruppen, um die Hamas im Gazastreifen zu zerschlagen. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten palästinensischen Gesundheitsbehörde mehr als 62.000 Menschen getötet. Diese Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen und es fallen sowohl Zivilisten als auch Hamas-Mitglieder darunter.
Momentan halten nur noch 15 Prozent der Deutschen die militärische Reaktion Israels für angemessen, für 63 Prozent geht sie zu weit, für 5 Prozent nicht weit genug. In dieser Lage werden verschiedene Sanktionen gegen Israel diskutiert.
Als die EU-Kommission Mitte September wirtschaftliche Sanktionen gegen Israel vorschlug, zeigten sich SPD-Politiker dafür offen, Unions-Vertreter skeptisch und der Sprecher der Bundesregierung ließ verlauten, die Bundesregierung habe sich noch keine abschließende Meinung dazu gebildet.
Im aktuellen ARD-DeutschlandTrend unterstützt eine Mehrheit von 55 Prozent den EU-Vorschlag, bestehende Handels- und Zollerleichterungen mit Israel auszusetzen. Halb so viele (27 Prozent) sind der Meinung, Deutschland sollte die Sanktionspläne nicht unterstützen.
Mehrheit gegen Ausschluss Israels von ESC und UEFA-Wettbewerben
Auch eine Anerkennung Palästinas als eigenständiger Staat - so wie es mehrere Länder wie Frankreich, Belgien oder Spanien zuletzt getan haben - würde eine Mehrheit der Deutschen (55 Prozent) begrüßen. 25 Prozent trauen sich in dieser Frage kein Urteil zu. Jeder Fünfte (20 Prozent) unterstützt den aktuellen Kurs Deutschlands, Palästina nicht als eigenständigen Staat anzuerkennen. Außenminister Johann Wadephul (CDU) begründet seine Zurückhaltung damit, ein solcher Schritt könne nicht am Anfang, sondern erst am Ende auf dem Weg zu einer Zweistaatenlösung stehen.
Eine andere Diskussion geht für viele Bürgerinnen und Bürger zu weit. Gegenwärtig wird für internationale Großevents wie den Eurovision Song Contest oder Sportveranstaltungen des Europäischen Fußballverbands UEFA über einen Ausschluss Israels diskutiert. Jeder Vierte (24 Prozent) fände es richtig, mit einem Ausschluss Druck auf die israelische Regierung auszuüben. Zwei Drittel (65 Prozent) indes sind der Meinung, israelische Künstler und Sportler dürften nicht für das Handeln der israelischen Regierung bestraft werden.
Gleichzeitig hält eine relative Mehrheit der Deutschen hierzulande mehr Anstrengungen im Kampf gegen Antisemitismus für nötig. Für 40 Prozent gehen diese Anstrengungen in Deutschland nicht weit genug. 35 Prozent halten sie für ausreichend. Jedem Zehnten gehen sie zu weit.
Untersuchungsanlage Grundgesamtheit: Wahlberechtigte in DeutschlandErhebungsmethode: Zufallsbasierte Online- und Telefon-Befragung (davon 60 Prozent Festnetz, 40 Prozent Mobilfunk)
Erhebungszeitraum: 29. September bis 1. Oktober 2025
Fallzahl: 1.306 Befragte (779 Telefoninterviews und 527 Online-Interviews)
Gewichtung: nach soziodemographischen Merkmalen und Rückerinnerung Wahlverhalten
Schwankungsbreite: 2 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 10 Prozent, 3 Prozentpunkte bei einem Anteilswert von 50 Prozent
Durchführendes Institut: infratest dimap
Die Ergebnisse sind auf ganze Prozentwerte gerundet, um falsche Erwartungen an die Präzision zu vermeiden. Denn für alle repräsentativen Befragungen müssen Schwankungsbreiten berücksichtigt werden. Diese betragen im Falle einer Erhebung mit 1.000 Befragten bei großen Parteien rund drei Prozentpunkte, bei kleineren Parteien etwa einen Punkt. Hinzu kommt, dass der Rundungsfehler für kleine Parteien erheblich ist. Aus diesen Gründen wird keine Partei unter drei Prozent in der Sonntagsfrage ausgewiesen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke