Höhenwindrad im Bau: Die Lausitz greift nach den Wolken
Zeit, dass es sich dreht: Das höchste Windrad der Welt
Superlative in der Lausitz: 365 Meter werden die Rotoren des Windrades in die brandenburgische Luft ragen. Auf 300 Metern Höhe werden die Rotoren angebracht, so hoch wie bei keinem zweiten Windrad. Das Höhenwindrad muss sich in der Höhe nur dem Berliner Fernsehturm (368 Meter) geschlagen geben: "Wir könnten höher, nochmal 50 Meter mehr mit der jetzigen Technologie", sagt Jochen Großmann, Chef des zuständigen Ingenieurbüros Gicon aus Dresden, "aber wir wollten nicht das höchste Bauwerk Deutschlands errichten".
Der Generator, den die Räder bald speisen, ist hingegen eher Standardware: Mit einer Leistung von 3,8 Megawatt ist er im Vergleich zu heutigen Anlagen gering ausgelegt (siehe weiter unten die aktuellen Zahlen zum Ausbau der Windenergie). Es ist die Höhe, die den Unterschied macht. Ein Jahr lang haben die Planer des Höhenwindrades aus Dresden und Leipzig mit einem Messmast die Windgeschwindigkeiten in 300 Metern und im Vergleich dazu in 150 Metern Höhe gemessen.
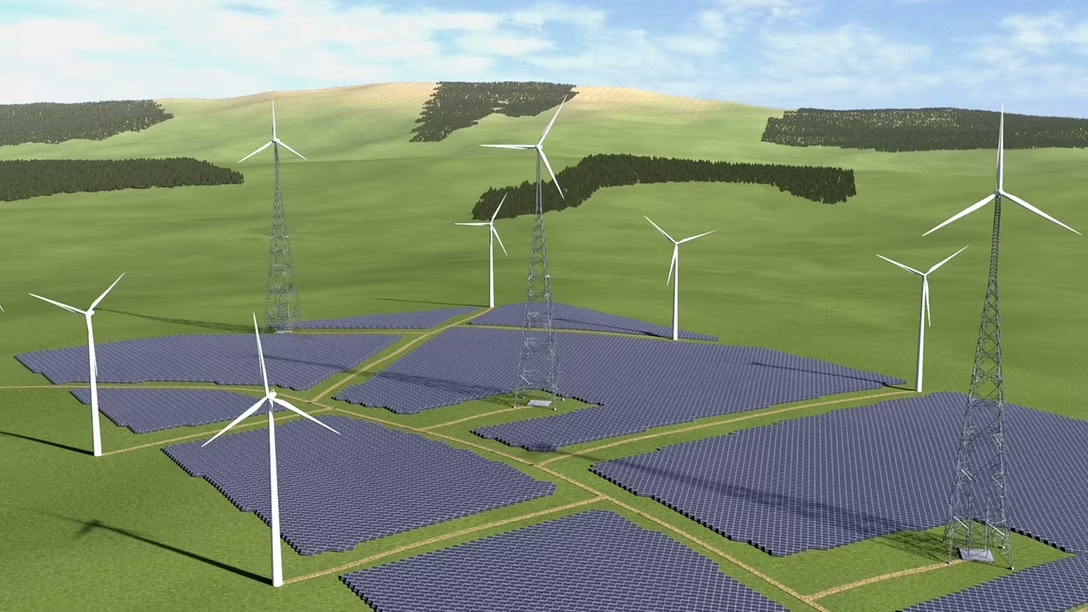 Bildrechte: Gicon
Bildrechte: GiconErgebnis: In 300 Metern Höhe sind die Winde deutlich stärker und es treten seltener ganz schwache Winde auf. Gerade in den windreichen Wintermonaten kann die Pilotanlage ihre Höhe ausspielen. So kann laut den Messungen des zuständigen Ingenieurbüros Gicon das Höhenwindrad konstantere Leistungen über das ganze Jahr erbringen als eine herkömmliche Anlage. Die steht bei schwachen Windstärken auch mal still. Die Pilotanlage mit 3,8 Megawatt soll doppelt so viel Strom erzeugen wie eine kleinere Anlage mit gleicher Generatorleistung. Nun ist Bau der Anlage gestartet.
Das ausfahrbare Windrad
Das Baukonzept weist eine weitere Besonderheit auf: Statt aus einem festen Betongehäuse besteht das Höhenwindrad aus einem Stahlgitter: Eine Bauweise, die bereits bei Strommasten eingesetzt wird. Das Höhenwindrad ist zusätzlich ausfahrbar: Die Windräder mit Generator und Rotoren lassen sich für den Betrieb wie ein Teleskop auf eine Nabenhöhe von 300 Meter ausziehen. Für die Wartung kann die Anlage dann wieder abgesenkt werden.
Bei den Messungen im vergangenen Jahr wurde auch untersucht, inwieweit Fledermäuse durch die Anlage beeinträchtigt werden: Laut den Untersuchungen sind die Tiere in einer Höhe von 300 Metern weit weniger aktiv als bei Anlagen, die ca. 150 Meter hoch sind. Dadurch könnten Kollisionen vermieden werden, sind die Betreiber überzeugt.
Windparks mit mehreren Etagen
Die Anlage soll 2026 in Betrieb gehen – ein Jahr später als ursprünglich geplant – und einen bestehenden Windpark ergänzen. Das ist auch eines der Anliegen der Ingenieure: Ihre Höhenwindräder könnten eine Art zweite Etage in vorhandene Windparks einführen. So könnten schwächere Windleistungen weiter unten und stärkere Windleistungen weiter oben gleichermaßen angezapft werden. Dadurch könnten Windparkbetreiber langwierige Genehmigungsverfahren umgehen.
(Zu) viel Wind um das Höhenwindrad?
In der Fachagentur Wind und Solar sieht man dieses Konzept hingegen kritisch: Denn die Anlagen, die heute und in den kommenden Jahren gebaut werden, erreichen selbst bereits Höhen von 250 Metern und aufwärts. So könnte das "Etagen"-Prinzip kannibalisiert werden, da sich die Anlagen gegenseitig den Wind streitig machen würden. Kleinere Anlagen werden außerdem zunehmend abgebaut und "repowert" und stehen mittelfristig immer weniger in der Landschaft. Dieses Problem sieht Ingenieur Jochen Großmann von Gicon nicht. Denn auf dem Höhenwindrad können auch kleine Rotoren aufgebaut werden. Wichtig sei nicht die Spitzenleistung mit großen Rotoren, sondern die stetige Leistung auch mit kleineren Windrädern.
Jürgen Quentin, Experte für Energiewirtschaft bei der FA Wind und Solar, sieht noch ein weiteres Problem beim Höhenwindrad: "Je höher ich die Anlage baue, desto eher komme ich in Bereiche, wo militärische Flughöhen erreicht werden, so dass es da zu Konflikten kommen kann." Bereits heute gebe es bei kleineren Anlagen regelmäßig Nutzungskonflikte mit der Luftfahrt – die dann auch zu einem Genehmigungsstopp der Anlagen führen könnten, erklärt der Experte. Das Höhenwindrad in Schipkau ist als Pilotanlage, als wissenschaftlicher Versuch angelegt, um die Technik zu erproben und zu verbessern.
Günstige Winde für die Windenergie: Bilanz für das erste Halbjahr 2025
Im ersten Halbjahr 2025 wurden so viele Windenergieanlagen genehmigt wie noch nie zuvor in einem halben Jahr. Das zeigt die Auswertung der Fachagentur Wind und Solar. Anlagen mit einer Leistung von 7.851 Megawatt (MW) wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres von den Behörden genehmigt.
Das sind bereits jetzt mehr als im gesamten Jahr 2023. Spitzenreiter bei den Verfahren für neue Windanlagen ist wie schon im vergangenen Jahr Nordrhein-Westfalen. Die Behörden werden laut den Angaben der FA Wind auch schneller bei der Zulassung der Anlagen: 18 Monate dauert das Verfahren bis zur Genehmigung. Im Vorjahr waren es noch 23 Monate.
Allerdings ist es von der Genehmigung bis zur Umsetzung noch immer ein weiter Weg: Im Schnitt dauert es 27 Monate, bis ein genehmigtes Windrad schlussendlich Strom erzeugt. Die Bundesnetzagentur muss konkrete Windräder erst noch ausschreiben, was lediglich einmal im Quartal passiert. Manchmal muss ein neuer Rotor nachgenehmigt werden, auch der Schwerlasttransport der Windradflügel kann den Bau in die Länge ziehen. Seit kurzem klagen Windradbetreiber auch über Verzögerungen beim Netzanschluss der Anlagen.
Völlig durchgedreht: Leistung der Windräder steigt
Auch bei den realisierten Windrädern zeigt sich ein Aufwärtstrend: Im ersten Halbjahr wurden netto (also nach Abzug von stillgelegten Windrädern) 199 neue Windräder errichtet und 138 Anlagen repowert. Insgesamt wurden so 1.876 MW Leistung zugebaut. Das ist der höchste Wert seit 2017.
Auch die einzelnen Windkraftanlagen werden immer leistungsfähiger: Im Schnitt haben die Anlagen eine Nennleistung von 5,4 Megawatt. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren hatten die neuen Anlagen noch eine Leistung von 2,7 MW, eine Verdopplung innerhalb einer Dekade.
Links/Studien
Den Status der Windenergieausbaus an Land im 1. Halbjahr 2025 können Sie hier nachlesen.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke


