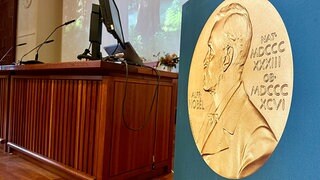Reizüberflutung bei Kindern: Zwischen Mathe und Deutsch eine Stunde Achtsamkeit
- Warum Reizüberflutung den Schulalltag verändert und was dagegen helfen kann.
- Wut verstehen statt ausrasten: Achtsamkeit als Schlüssel zur Konfliktbewältigung.
- Bildung neu denken: Ein Reallabor in Sachsen-Anhalt will Kinder auf den Wandel vorbereiten.
- Filterkompetenz statt Faktenflut: Was Kinder aus Sicht von Bildungsforschern heute wirklich lernen sollten.
Kurze Pause in der Grundschule "Am Grünen Gleis" in Leipzig: Pauline und Simon aus der 1d machen sich auf den Weg zum Achtsamkeitsunterricht. Gewusel kann Lehrerin Elisabeth Wilkens jetzt nicht gebrauchen. Deswegen ist in der Achtsamkeitsstunde immer nur die halbe Klasse dabei. Jedes Kind setzt sich auf eine Yogamatte – das bereitliegende Kissen wandert wahlweise unter den Po oder bei den Spaßvögeln auf den Kopf.
Zur Einstimmung üben die Kinder, still zu sitzen wie ein hungriger Frosch, der eine fette Fliege im Fokus hat. Auf ein Zeichen ihrer Lehrerin klatschen die Kinder in die Hände: die imaginäre Fliege ist gefangen.
 In angeleiteten Übungen lernen die Kinder unter anderem, wie sie mit schwierigen Gefühlen besser umgehen können.Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
In angeleiteten Übungen lernen die Kinder unter anderem, wie sie mit schwierigen Gefühlen besser umgehen können.Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNKKinder heute sind viel mehr Reizen ausgesetzt
Achtsamkeit gehört zum Schulprofil der Grundschule im Leipziger Südwesten. In den ersten und zweiten Klassen steht jede Woche eine Stunde Achtsamkeit auf dem Stundenplan. Schulleiterin Steffi Weiß will damit die Grundlage schaffen für gemeinsames Lernen. Diese Basis sei abhandengekommen. Schulklassen damals und heute seien nicht mehr vergleichbar.
 Schulleiterin Steffi Weiß beobachtet, wie sich die Lebensrealitäten von Kindern verändert haben.Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Schulleiterin Steffi Weiß beobachtet, wie sich die Lebensrealitäten von Kindern verändert haben.Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNKHeutzutage seien die Lebensrealitäten der Kinder extrem unterschiedlich. "Kinder kommen vermehrt aus dualen Familiengefügen. Sprich: Sie leben im Wechselmodell. Wir haben Kinder mit Migrationshintergrund, die verschiedene Sprachen sprechen. Manche bringen psychische Probleme mit", sagt Weiß. Und es strömten viele Reize auf sie ein. "Die Kinder kommen schon sehr früh mit digitalen Medien in Berührung, zum Teil schon unter drei Jahren. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Miteinander."
Die Klassen seien zudem sehr voll. Die passende Antwort auf diese Problemlagen sieht Schulleiterin Weiß in ihrem Achtsamkeitsprofil. Um ihr Schulkonzept leben zu können, gibt es weniger Förderunterricht in Deutsch oder Mathe. Irgendwo müssen die Kapazitäten herkommen.
Wut darf da sein, aber …
Zurück zum Achtsamkeitsunterricht der halben Klasse 1d. Nach dem meditativen Einstieg geht es mit dem Thema Gefühle weiter. "Wir haben exemplarisch das Gefühl Wut herausgenommen. Wir haben schon öfter besprochen, wie wir damit umgehen können – ohne Zerstörung oder Verletzungen. Und trotzdem darf die Wut da sein", erklärt Achtsamkeitslehrerin Elisabeth Wilkens.
Jedes Gefühl ist wichtig und hat eine Funktion.
Wilkens unterrichtet auch Deutsch, Sachunterricht und Kunst. Wie viele andere Lehrkräfte am "Grünen Gleis" lässt sie Achtsamkeitselemente auch im Fachunterricht einfließen. Das finde sie teilweise sogar wichtiger als die Rechtschreibregeln in Deutsch, sagt sie: "Dass wir uns dafür Zeit nehmen, wenn ein Thema auf dem Tisch liegt." Denn jedes Gefühl sei wichtig und habe eine Funktion, das erkläre sie den Kindern immer wieder.
 Neben Achtsamkeit unterrichtet Lehrerin Elisabeth WIlkens auch Deutsch, Sachunterricht und Kunst.Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Neben Achtsamkeit unterrichtet Lehrerin Elisabeth WIlkens auch Deutsch, Sachunterricht und Kunst.Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNKLernen, mit Veränderungen umzugehen
Ortswechsel ins mitteldeutsche Braunkohlerevier: Hier setzt die Initiative Zukunftsbildung einen anderen Fokus. Es geht darum, Wandel positiv wahrzunehmen und die kindliche Neugierde zu erhalten. In Hohenmölsen, im Süden Sachsen-Anhalts, hat die Initiative dafür ein – wie sie es nennt – Reallabor gegründet. Ziel sind neue Bildungskonzepte.
Gründer der Initiative Zukunftsbildung ist Michael Fritz. Er verweist darauf, dass die heutigen Kita- und Grundschulkinder eine Lebenserwartung bis zum Jahr 2100 oder darüber hinaus haben. "Die Veränderungsdynamik und das Veränderungstempo werden größer und damit umzugehen, wird herausfordernder", erklärt er. "Wir wollen, dass Kinder lernen, dass Veränderung normal ist, dass sie damit umgehen können."
Bildungsforscher: Andere Kompetenzen sollten nicht zu kurz kommen
Was sollten Kinder heute lernen, um fit für die Zukunft zu sein? Mit der Frage beschäftigt sich auch Bildungsforscher Kai Maaz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung. Letztlich brauche es ein Zusammenspiel verschiedener Kompetenzen: "Ich unterscheide zwischen basalen Kompetenzen. Das sind kognitive Kompetenzen, die man braucht, um überhaupt erst lernen zu können – im sprachlichen, im naturwissenschaftlichen, im mathematischen Bereich. Außerdem gibt es die funktionalen Kompetenzen. Das sind Kompetenzen, die Kinder befähigen, sich begeistern zu können, Durchhaltevermögen, Selbstwirksamkeit zu entwickeln."
 Bildungsforscher Kai Maaz betont, das reine Anhäufen von Wissen könne heute nicht mehr der Zweck von Schule sein.Bildrechte: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld
Bildungsforscher Kai Maaz betont, das reine Anhäufen von Wissen könne heute nicht mehr der Zweck von Schule sein.Bildrechte: picture alliance/dpa | Kay NietfeldStatt diese Bereiche gegeneinander auszuspielen, müsse man sie gut verzahnen. Fakt ist für Maaz: Das reine Anhäufen von Wissen könne nicht mehr der Zweck von Schule sein. "Wissen kann ich mir zu jeder Zeit, an jedem Ort zugänglich machen. Das Entscheidende ist, daraus Zusammenhänge abzuleiten, dass ich es anwenden kann", sagt Maaz. Gerade im Zeitalter digitaler Technologien, in der wir mit Informationen zugeschüttet würden, müssten Kinder eine Kompetenz entwickeln, die er Filterkompetenz nennt: "Zu entscheiden, mit welcher Information arbeite ich weiter, um daraus auch Kompetenzen entstehen zu lassen."
Wissen kann ich mir zu jeder Zeit, an jedem Ort zugänglich machen. Das Entscheidende ist, daraus Zusammenhänge abzuleiten.
Wert auf Achtsamkeit in der Schule zu legen, findet der Bildungsforscher gut – mit einer Einschränkung: Solange die anderen Kompetenzen, etwa die sprachlichen, nicht darunter leiden.
In der Grundschule am Grünen Gleis ist der Achtsamkeitsunterricht jetzt vorbei. Zum Abschluss haben sich die Erstklässler in Decken gekuschelt – einige ruhige Minuten bewusste Entspannung, bevor der wuselige Schulalltag weitergeht. Wie begegnet Schulleiterin Steffi Weiß Kritikern ihres Schulkonzepts? Sie nennt ihre Erfolge: weniger Konflikte und ein besseres, achtsameres Miteinander an der Schule.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke