Radikalisierte Einzeltäter: Wie Sicherheitsbehörden an ihre Grenzen stoßen
- Beängstigende Parallelen: Wie sich das Denken des Täters von Magdeburg und Ahmed A. ähneln
- Schwere Arbeit der Sicherheitsbehörden: Uneinheitliche Gefährder-Definitionen
- Unberechenbare Täter: Wenn persönliche Kränkung zur Radikalisierung führt
- Drohungen gegen den Staat: Wie ernst ist Ahmed A. zu nehmen
- Extremismus ohne klare Ideologie: Warum alte Kategorien nicht mehr greifen
Taleb Abdulmohsen war polizeibekannt, vorbestraft und fiel über Jahre mehrfach durch Gewaltdrohungen auf. Am 20. Dezember 2024 raste der Mann aus Saudi-Arabien mit seinem Auto über den Magdeburger Weihnachtsmarkt. Sechs Menschen starben, Hunderte wurden verletzt, Tausende leiden unter den Folgen. Seit dem Anschlag wird diskutiert, warum Abdulmohsen nicht früher gestoppt wurde – und wie viele potenzielle Gefährder von den Sicherheitsbehörden möglicherweise nicht erfasst werden.
 Ahmed A. hat im Interview mit MDR Investigativ Verständnis für den Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt geäußert. Er kannte den Täter persönlich.Bildrechte: MDR Investigativ
Ahmed A. hat im Interview mit MDR Investigativ Verständnis für den Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt geäußert. Er kannte den Täter persönlich.Bildrechte: MDR Investigativ"Ich denke jede Minute daran", sagt Ahmed A. über den Anschlag in Magdeburg. Der Mann aus Mekka in Saudi-Arabien ergänzt: "Ich habe keine konkrete Zeit. Aber es ist so weit, die Kugel ist schussbereit." Der 43-Jährige äußert Verständnis für die Tat: "Das war eine Racheaktion aus persönlichen Gründen. Jeder, dem das Gleiche passiert wäre wie Taleb, würde sich auf die gleiche Weise rächen."
Beängstigende Parallelen: Wie sich das Denken des Täters von Magdeburg und Ahmed A. ähneln
Ahmed A. habe Abdulmohsen, der ebenfalls aus Saudi-Arabien stammt, über Twitter kennengelernt, erklärt er im Interview mit MDR Investigativ: "Er schrieb gegen den Islam oder über Atheismus. Dies war das Thema, das uns zusammengebracht hat", so Ahmed A.. Abdulmohsen habe ihm "den Weg aufgezeigt, wie ich ein Visum und ein Ticket bekomme."
Abdulmohsen habe sich verfolgt gefühlt, erzählt Ahmed A. – von Behörden, von der Gesellschaft. Eine Sichtweise, die auch er selbst habe: "Bis vor kurzem litt ich beispielsweise unter der Korruption der Behörden. Sie führen Krieg gegen dich, nur weil du ein Saudi bist." Deshalb sei der Anschlag eine Reaktion aus Rache gewesen.
Ermittlungen in Erfurt: Was passierte nach dem Interview
Die Recherchen zum Täter von Magdeburg führten Reporter von MDR Investigativ zu Ahmed A., einem Bekannten des Täters. Im Interview sagte er unfassbares: Er heißt die Tat gut und bedauert, dass es nicht noch mehr Opfer gab.
Kurze Zeit später ist er nicht mehr erreichbar und auch für die Polizei offenbar spurlos verschwunden. Wichtigtuer oder ernstzunehmender Gefährder? Schließlich hatte auch Taleb Abdulmohsen eine Tat mehrmals angekündigt.
Wie viele solcher Gefährder leben in Deutschland?
Ein Sprecher des Bundeskriminalamts teilte im Juni mit, dass das BKA derzeit 561 Gefährder erfasst hat. Diese verteilten sich auf die Phänomenbereiche – links, rechts, ausländische Ideologien und sonstiges.
Auf eine Anfrage an die Innenministerien der 16 Bundesländer antworten einige mit konkreten Zahlen. So schreibt Bayern, dass im Freistaat Ende April 43 Personen als Gefährder geführt wurden. In Nordrhein-Westfalen galten Ende März 205 Personen als Gefährder.
Sachsen teilt mit, dass aktuell Fahndungen nach Personen mit dem Status Gefährder im unteren einstelligen Bereich liefen. "Die Gesuchten haben überwiegend Bezüge zur politisch motivierten Kriminalität – links- sowie (...) religiöse Ideologie." Ähnlich ist es offenbar in Sachsen-Anhalt.
Andere Länder, wie Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern geben keine Auskunft – aus Sicherheitsgründen. Was dabei auffällt: Eine einheitliche Systematik fehlt offenbar.
Schwere Arbeit der Sicherheitsbehörden: Uneinheitliche Gefährder-Definitionen
 Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz kritisiert die unterschiedlicher Definition von Gefährdern in den Bundesländern in Deutschland und auf europäischer Ebene.Bildrechte: MDR Investigativ
Der Grünen-Politiker Konstantin von Notz kritisiert die unterschiedlicher Definition von Gefährdern in den Bundesländern in Deutschland und auf europäischer Ebene.Bildrechte: MDR Investigativ"Die föderale Struktur und unterschiedliche Gefährderdefinitionen sind ein massives Problem", kritisiert Grünen-Politiker und Mitglied des Bundestagsinnenausschusses, Konstantin von Notz. Auf europäischer Ebene sei es noch komplizierter. "Die unterschiedlichen Sicherheitsbehörden können sich überhaupt nicht richtig verständigen darüber, wer jetzt wie gefährlich ist."
Die unterschiedlichen Sicherheitsbehörden können sich überhaupt nicht richtig verständigen darüber, wer jetzt wie gefährlich ist.
Doch das Problem ist wohl noch größer. Selbst dort, wo Gefährder erfasst werden, stoßen die Behörden an Grenzen. Denn viele lassen sich nicht mehr klar zuordnen – zu keiner eindeutigen Ideologie, keinem Netzwerk. Es sind Einzeltäter. Unberechenbar, oft isoliert - und potenziell gefährlich.
Unberechenbare Täter: Wenn persönliche Kränkung zur Radikalisierung führt
"Wir sprechen hier von einer persönlichen Kränkungsideologie", erklärt Florian Hartleb, Professor an der Modul-Universität Wien. "Das heißt, es kommen hier Radikalisierungsprozesse zusammen, die entstehen durch persönliche Frustrationen, persönliche Kränkungen, aber die eben auch im Zusammenhang stehen mit politischer Radikalisierung. Und der Einzeltäter hat eben auch ein großes Sendungsbewusstsein, was ja dazu führt, dass er dann eben am Tag XY losschlägt."
Das heißt, es kommen hier Radikalisierungsprozesse zusammen, die entstehen durch persönliche Frustrationen, persönliche Kränkungen, aber die eben auch im Zusammenhang stehen mit politischer Radikalisierung.
Es gibt mehrere Fälle, in denen Täter ihre Absichten im Vorfeld äußerten – und dennoch nicht rechtzeitig gestoppt werden konnten. Beispiel: Stephan Balliet. Der rechtsextreme Attentäter von Halle veröffentlichte vor dem Anschlag ein antisemitisches Manifest. Er kündigte seine Tat im Netz an – und marschierte trotzdem am höchsten jüdischen Feiertag unbehelligt zur Synagoge. Zwei Menschen hat er getötet.
Auch Taleb Abdulmohsen, der Täter des Anschlages in Magdeburg, drohte – öffentlich, im Internet. Die Aussagen von Ahmed A. werfen die Frage auf, wie groß das Risiko ist, dass Personen mit ähnlichem Gedankengut selbst gewalttätig werden könnten.
Spurensuche: Was über Ahmed A. bekannt ist
Auf die Anfrage von MDR Investigativ teilt das LKA Sachsen schriftlich mit: "Das LKA Sachsen nimmt den Sachverhalt sehr ernst. Bezüglich der Ermittlungen stehen wir im engen Austausch mit Polizeien anderer Bundesländer – auch um die uns vorliegenden Erkenntnisse anzureichern und zu verdichten."
Ahmed A. ist nach eigenen Angaben 2017 in der Erstaufnahmeeinrichtung in Halberstadt angekommen und habe dort einen Asylantrag gestellt, der nach 45 Tagen abgelehnt worden sei. MDR Investigativ erhielt per WhatsApp Dokumente von ihm: Strafbefehle vom Amtsgericht Halberstadt, datiert auf Mai 2023. Vorwurf: Beleidigung eines Polizeibeamten. Weitere Tatvorwürfe: Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung – im Oktober 2022.
Ahmed A. sieht sich diskriminiert und zu Unrecht beschuldigt. Er schickt eine Sprachnachricht: "Sie legen immer mehr Holz ins Feuer." Was er offenbar meint: Die Strafverfahren seien für ihn nur der nächste Akt staatlicher Willkür.
Rache an Deutschland als Motiv
Doch wie ernst ist das zu nehmen? Hans Goldenbaum ist Islamwissenschaftler und Radikalisierungsforscher aus Halle. Er hat zu Taleb Abdulmohsen, den Täter von Magdeburg, ein Gutachten erstellt. Als er das Interview mit Ahmed A. anschaut, erkennt er Parallelen: "Der Rachegedanke ist hier ganz zentral. Das ist auch das Verbindende eigentlich hier zum Anschlag in Magdeburg." Es solle Rache am Staat, dessen Institutionen und der deutschen Bevölkerung genommen werden.
Darum ging es mutmaßlich Abdulmohsen bei seinem Anschlag in Magdeburg. Es fehle auch eine umfassendere politische oder ideologische Kontextualisierung. "Hier geht es darum: Ich bin nach Deutschland gekommen und habe den deutschen Staat erlebt als jemanden, der mich persönlich verfolgt, verletzt, kränkt. Und daran möchte ich Rache nehmen", sagt Goldenbaum.
In beiden Biografien finden sich Hinweise auf ein tiefsitzendes Bedürfnis nach Vergeltung gegenüber dem Staat und der Gesellschaft: Taleb Abdulmohsen, der Attentäter von Magdeburg. Und Ahmed A., der im Interview Drohungen ausgesprochen hatte.
Drohungen gegen den Staat: Wie ernst ist Ahmed A. zu nehmen?
 Hans Goldenbaum ist Islamwissenschaftler und Radikalisierungsforscher aus Halle. Er hat auch zu Taleb Abdulmohsen, den Täter von Magdeburg, ein Gutachten erstellt.Bildrechte: MDR Investigativ
Hans Goldenbaum ist Islamwissenschaftler und Radikalisierungsforscher aus Halle. Er hat auch zu Taleb Abdulmohsen, den Täter von Magdeburg, ein Gutachten erstellt.Bildrechte: MDR Investigativ"Ich habe alle Behörden bedroht", hatte Ahmed A. gesagt. "Ich werde die Stadt und alle darin niederbrennen." Ihm sei daraufhin erklärt worden, dass das eine Bedrohung der Sicherheit sei und er habe eine Erklärung unterzeichnen müssen, diese Drohung nicht umzusetzen. "Andererseits habe ich meine Rechte nicht bekommen. Flüchtling auf der Straße, obdachlos."
Es könnte sein, dass er in drei Monaten was macht. Es könnte sein, dass er morgen was macht. Es kann auch sein, dass er gar nichts macht.
Wie groß ist die Gefahr, dass er seine Drohung wahrmacht? "Bei ihm ist es so, dass wir sagen können, das könnte sein, dass er in drei Monaten was macht", sagt Radikalisierungsforscher Goldenbaum. "Es könnte sein, dass er morgen was macht. Es kann auch sein, dass er gar nichts macht."
Das sei das große Dilemma bei einer narzisstischen Persönlichkeit, wie der von Ahmed A., so Goldenbaum. Da müsse zur persönlichen Kränkung noch ein Trigger hinzukommen, dass er tatsächlich selbst zur Tat schreite.
Extremismus ohne klare Ideologie: Warum alte Kategorien nicht mehr greifen
Wer heute Hass verbreitet, passt längst nicht mehr in gängige Schubladen, Grenzen zwischen Ideologien verschwimmen. "Das ist etwas, das wir für unsere aktuelle Sicherheitslage sowieso lernen müssen", sagt das Mitglied des Innenausschusses des Bundestages, von Notz. Das Spektrum der Personen, die Anschläge begehe, sei inzwischen sehr, sehr breit.
"Die Kategorisierung, die wir über Jahrzehnte hatten, also sozusagen, das ist ein Gefährder Rechts, das ein Gefährder Links, der kommt aus dem islamistischen Bereich, das ist eher so Reichsbürger und die sind ja sowieso nur ein bisschen verrückt oder so. Diese Kategorisierung passt nicht mehr", so der Politiker.
Ahmed A. im Fokus: Behörden in Thüringen übernehmen Fall
Von Ahmed A. war wochenlang nichts zu hören. Am 5. Juni gab es eine Nachricht vom LKA Sachsen: Ahmed ist in Erfurt aufgetaucht. Ab sofort seien die Behörden in Thüringen zuständig.
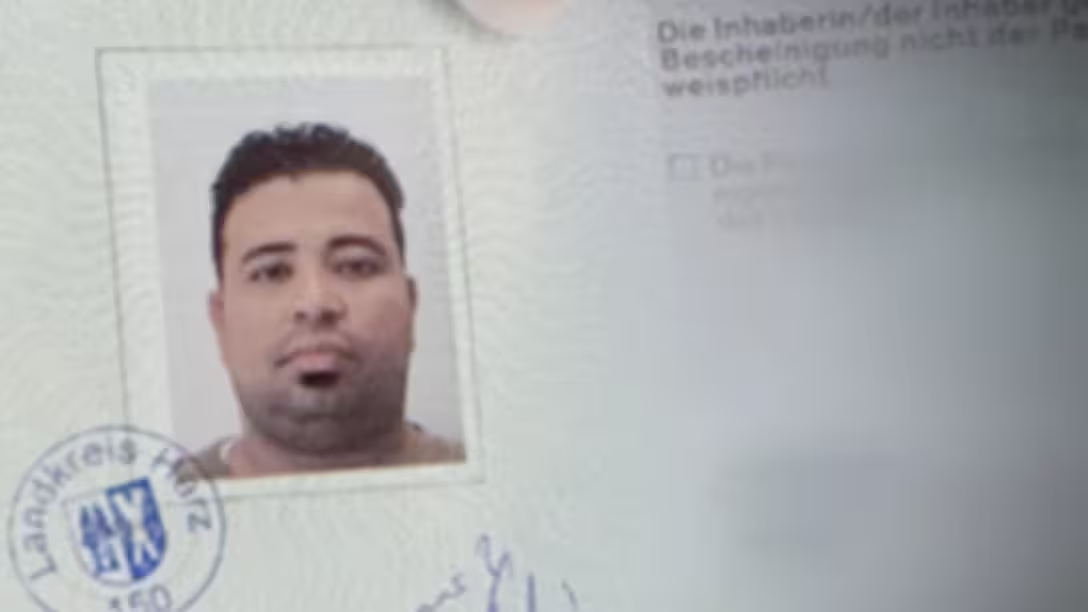 Ahmed A. reiste 2016 erstmals in das Bundesgebiet ein. Der Asylantrag von ihm wurde durch das BAMF abgelehnt. Dagegen ging er gerichtlich vor.Bildrechte: MDR Investigativ
Ahmed A. reiste 2016 erstmals in das Bundesgebiet ein. Der Asylantrag von ihm wurde durch das BAMF abgelehnt. Dagegen ging er gerichtlich vor.Bildrechte: MDR InvestigativWas wissen die dortigen Ermittler über seinen Aufenthaltsstatus? Die Polizeidirektion Erfurt antwortet schriftlich: "Herr A. reiste 2016 erstmals in das Bundesgebiet ein. Seinen Asylantrag hat das BAMF abgelehnt, wogegen er gerichtlich vorging. Zuvor gab es zwei erfolglose Abschiebeversuche. Schließlich wies das Verwaltungsgericht Magdeburg das BAMF an, ihm die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen."
Außerdem sei es den Behörden gelungen, "(…) mit Herrn Ahmad A persönlichen Kontakt aufzunehmen. Hier wurde auch eine Gefährderansprache durchgeführt. Seine bislang bekannten Anlaufpunkte werden nach wie vor geprüft, um Informationen über eine eventuelle neue Bleibe zu erlangen.” Ahmed A. ist nicht zur Festnahme ausgeschrieben, aber er steht unter Beobachtung.
Haftungsausschluss: Das Urheberrecht dieses Artikels liegt bei seinem ursprünglichen Autor. Der Zweck dieses Artikels besteht in der erneuten Veröffentlichung zu ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Sollten dennoch Verstöße vorliegen, nehmen Sie bitte umgehend Kontakt mit uns auf. Korrektur Oder wir werden Maßnahmen zur Löschung ergreifen. Danke


